PistenManagement im Klimawandel

Wie müssen wir uns auf die Zukunft des PistenManagements in Zeiten des Klimawandels einstellen? Dieser für die Pistenbetreiber immer wichtiger werdenden Frage widmeten sich am 18. 9. in Mayrhofen die Teilnehmer der Veranstaltung Flora, Schnee und PistenManagement im Klimawandel des Kompetenzzentrums PistenManagement. Die von PowerGIS initiierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtung führte viele Praktiker mit namhaften Experten zur fruchtbaren Auseinandersetzung mit diesem beachtenswertenThema zusammen.
Sich mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu beschäftigen, kann viele Facetten haben. Eine davon ist, sich die Effekte und Prozesse der technischen Beschneiung sowie der anschließenden Pistenpräparierung in Bezug auf den Klimawandel näher anzusehen. In diesen Bereichen, die einen hohen Wasser- und Energieaufwand verursachen, lässt sich besonders viel in punkto Umweltschutz ausrichten. Um dieser Thematik Substanz zu verleihen und die Seilbahnunternehmen zu unterstützen, bot die Firma
PowerGIS in den Räumlichkeiten der Mayrhofner Bergbahnen AG 4 Experten auf: Umwelt: Dr. Bernhard Krautzer, Agricultural Research and Education Centre, Raumberg- Gumpenstein . Klimawandel: Dr. Robert Steiger, Management Center Innsbruck . Schneephysik: Dipl. Sport-Ing. Fabian Wolfsperger, WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung . Schneemanagement: Hansueli Rhyner, WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung/Abteilung Schneesport Dabei wurde auf den nötigen Praxisbezug geachtet, schließlich sollten die Ausführungen und Erkenntnisse auch in der täglichen Arbeit umsetzbar sein.
Ökologie und Ökonomie vertragen sich
Bernhard Krautzer hob in seinem Referat hervor, dass Pistenmanagement bereits bei einer intakten Pistenvegetation beginne. Die geeignete Vegetation werde durch die passende Hochlagen-Begrünung erzeugt, wobei es hier auf die richtige Saatgutmischung und kompetente Vorgangsweise ankomme. Jedoch könne eine erfolgreiche Pistenbegrünung letztlich nicht verordnet werden, vielmehr müssten Mitarbeiter der Bergbahnen aber auch Baufirmen im Umgang mit dem Boden geschult werden. Diesbezüglich könne man sich auch an das LFZ (Institut Lehr- und Forschungszentrum) Raumberg-Gumpenstein wenden. Auf jeden Fall sei es eine lohnende Investition für Pistenbetreiber, Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Oftmals stelle sich die Realität jedoch so dar, dass zwar ein Baubudget existiere, in diesem jedoch kein spezielles Begrünungsbudget enthalten sei oder aus Spargründen am Ende weggestrichen werde. Ein anderer häufiger Fehler sei es, bei baulichen Maßnahmen den vorhandenen Mutterboden zuzuschütten oder wegzuschieben, anstatt ihn zu erhalten. Fazit: Ökologie und Ökonomie vertragen sich sehr gut, und dies umso mehr, je extremer der Standort ist!
Bei Schneeproduktion an allen Schrauben drehen
Anschließend sprach Fabian Wolfsperger über die Einflussfaktoren auf die Effizienz der Schneeerzeugung. Gemäß seinen Ausführungen kommt es auf die Tropfengröße (kleiner ist besser), die Austrittsgeschwindigkeit, die Verdunstung, die Verfrachtung durch Wind sowie die Abflussverluste z. B. beim Schneien im Grenztemperaturbereich an. Grundsätzlich sei ein optimaler Durchfluss Voraussetzung für Effizienz. Die klassischen Technologien seien in Bezug auf mögliche Weiterentwicklungen limitiert deswegen existiere die Aussage, dass die Schneitechnik bei weiterer Klimaerwärmung den Skigebieten nichts mehr nütze.
Aber es gebe jetzt auch vielversprechende nicht-konventionelle Ansätze. Um bei der Schneeproduktion das Maximum herausholen zu können, müsse man wie im Spitzensport vorgehen: ständig an allen Schrauben drehen und optimieren. Nicht sinnvoll sei es jedenfalls, bei den Düsen eine Standardgröße für alle Höhenlagen einzusetzen.
Mit möglichst wenig Aufwand zu möglichst guten Pisten
Hansueli Rhyner machte auf die derzeit größte Herausforderung aufmerksam: Einerseits werde die Anforderung an die Pistenqualität immer höher, andererseits müsse man mit der Ressource Schnee immer behutsamer bzw. sparsamer umgehen! Wenn man jedoch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen trifft, spart man Maschinen- und Mannkosten und reduziert obendrein den CO2-Ausstoß. Also müsste es eigentlich ein Anliegen sein, mit möglichst wenig Aufwand möglichst gute Pisten herzustellen, so Rhyner wörtlich. Auf die Frage, wie sich eine qualitativ hochwertige Piste definiere, erklärte der Autor des Handbuches Pistenpräparation und Pistenpflege: möglichst hart, widerstandsfähig und homogen, eher nicht zu kupiert. Es soll keine Vereisung auftreten und sie soll den ganzen Tag über halten! Für die Pistenpräparierung besonders wichtig sei, dem sogenannten Sintern der Verdichtung des Schnees durch das Zusammenwachsen der sich berührenden Körner unmittelbar nach dem Schneefall genug Zeit zu geben. Die Schneedecke setzt sich durch ihr Gewicht, die Luft verschwindet mehr und mehr. Das Pistenfahrzeug verdichtet ebenfalls und macht die Hohlräume dann nochmals kleiner. Im Durchschnitt braucht der Sinterprozess 8 Stunden, je genauer und hochtouriger der Pistenfahrzeugfahrer fährt, umso besser ist es. Erst dann sollte man die Piste für Skifahrer öffnen.
Schneesicherheit auch noch in 30 Jahren in den meisten Skigebieten
Robert Steiger einer der Autoren des aktuellen Klimaberichts Austria stellte die Ergebnisse seiner Studie über die Schneesicherheit der Skigebiete im Klimawandel vor und zwar unter Einbeziehung der modernen Schneitechnik. Anlass war eine frühere Studie der OECD zu dieser Thematik, die jedoch ihre Schlüsse nur aufgrund ihrer Erkenntnisse über Veränderungen beim Naturschnee zog und folglich ein Ende des kommerziellen Skifahrens in 30 Jahren bei über 2° C Erwärmung prophezeite. Steigers Schneemodell für 300 Skigebiete, das von einer Kapazität von 3 Tagen für die Grundbeschneiung (30 cm) und 4° C Lufttemperatur ausgeht, kommt zu anderen Schlüssen: Es gibt auch in 30 Jahren noch Schneesicherheit in den meisten Skigebieten (also mindestens 100 Tage Skibetrieb auf Höhe Mittelstation), lediglich in Ost - österreich und dem Norden Bayerns könnte es problematischer werden. Bei + 4° C Erwärmung, die für ca. 2100 erwartet werden, sind die Problembereiche zwar noch weiter Richtung Westen vorgedrungen, aber im Zentralalpenraum und im Westen selbst funktioniert der Skibetrieb dank fortgeschrittener Schneitechnik noch immer! Am unsichersten bleibt der Zeitraum um Weihnachten: Während heute eine 80 %ige Wahrscheinlichkeit herrscht, dass auf 800 m zu Weihnachten ein Skibetrieb möglich ist, sinkt diese bei + 1°C Erwärmung auf 50 % und bei + 2° C gegen 0 %. Der vergangene Winter war übrigens um 3 °C wärmer als im Mittel und hat das Szenario schon vorweggenommen...
Artikel: Mountain Manager
PowerGIS Geografische Informationssysteme GmbH
Bayernstraße 45, A-5071 Wals-Siezenheim
T. +43 (0)662 89 09 52
F. +43 (0)662 89 09 52 - 50
office@powergis.at
www.pistenmanagement.at
Youtube >>>>
Twitter >>>>
Facebook >>>>
Ansprechpartner:
Robert Sölkner, Geschäftsführer
Sales & Business Development
+43 (0)699 16960000
robert@powergis.at
Ing. Christoph Schmuck, Technischer Leiter
Sales & Entwicklung
+43 (0)699 16960001
christoph@powergis.at





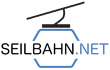


 Zurück
Zurück